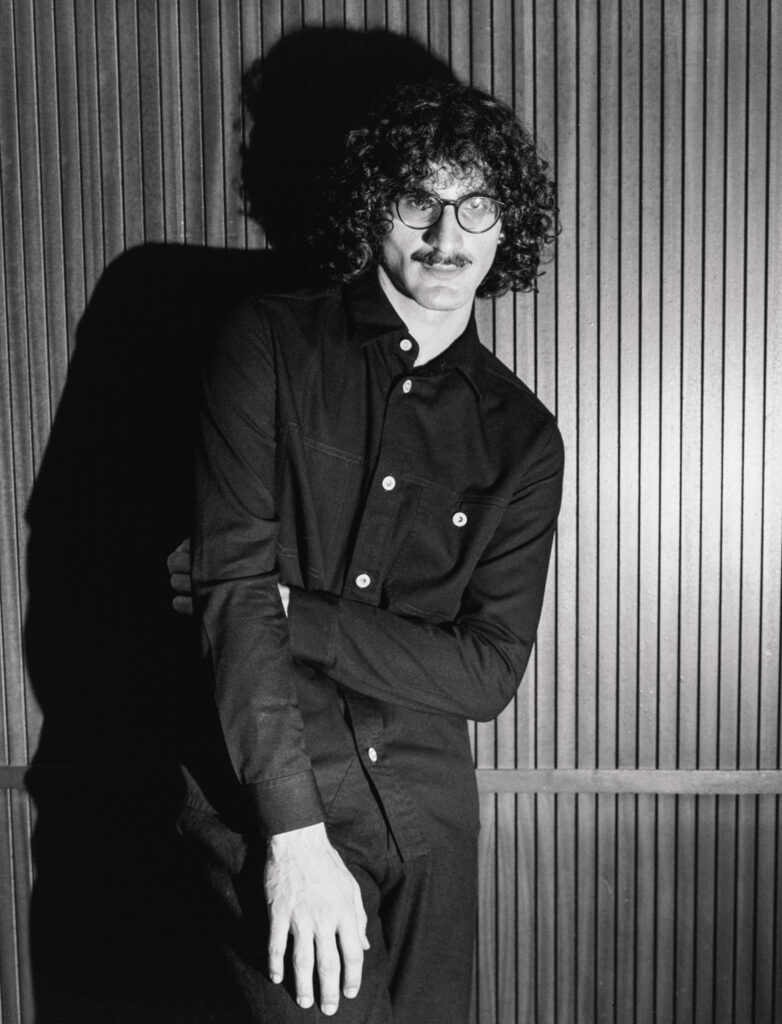18.45 Uhr Konzerteinführung im Saal Bodensee
19.30 Uhr Großer Saal
Das gesamte Jahresprogramm 2025/2026 können Sie hier digital ansehen.
John Adams (*1947)
Short Ride in a Fast Machine, Fanfare für Orchester (1986)
Samuel Barber (1910 – 1981)
Concerto for Violoncello and Orchestra, op. 22 (1945)
Allegro moderato
Andante
Molto allegro ed appassionato
Claude Debussy (1862 – 1918)
La Mer, L 111, 109 (1905)
I. De l’aube à midi sur la mer – très lent
(Morgengrauen bis Mittag auf dem Meer – sehr langsam)
II. Jeux de vagues – allegro
(Spiel der Wellen – Allegro)
III. Dialogue du vent et de la mer – animé et tumultueux
(Dialog zwischen Wind und Meer – lebhaft und stürmisch)
Maurice Ravel (1875 – 1937)
La Valse (Choreographische Dichtung für Orchester), M 72 (1920)
Der Konzertabend vereint vier berühmte Werke von vier Komponisten, die eine Charaktereigenschaft gemeinsam haben: John Adams, Samuel Barber, Claude Debussy und Maurice Ravel widersetzten sich in ihren Werken den kompositorischen Stilmitteln ihrer Zeit und fanden zu originellen, individuellen Ausdrucksformen. Alle vier Künstler erhielten und erhalten zu ihren Lebzeiten viel Anerkennung, und ihre Werke werden von renommierten Musiker:innen sowie Orchestern in vielen Konzertsälen der Welt gespielt. Stilistisch führen die Werke in musikalische Welten, die nicht primär auf melodischen Einfällen beruhen. Vielmehr bilden Tonfloskeln und Motive schillernde Klangflächen aus, die rhythmisch raffiniert verwoben werden. Dadurch verströmen die Werke eine vorwärtsdrängende Kraft, erzeugen eine große räumliche Weite oder führen die Zuhörenden in einen regelrechten Klangwirbel.
John Adams
Short Ride in a Fast Machine.
Fanfare für Orchester (1986)
Als kreativer Vordenker ist der amerikanische Komponist John Adams (*1947) einer der bedeutendsten Komponisten unserer Zeit. Bekannt wurde er vornehmlich im Umkreis der Minimal Music, die Steve Reich, Philip Glass und Terry Riley ab den 1970er-Jahren mitbegründet haben. John Adams führte diese Stilrichtung weiter und legt seinen Werken oft philosophische und auch politische Ausgangsgedanken zugrunde. Ein wesentliches Merkmal seiner Musik ist die Rhythmik. „Das Einzige ist der unaufhörliche Pulsschlag“, bringt der Komponist seine Stilistik auf den Punkt. Verbindend fügt er in seinen Werken musikalische Ideen aus dem Jazz, der Popmusik und der Klassik zusammen.
John Adams ist Klarinettist. Er studierte an der Harvard University, spielte zeitweise im Boston Symphony Orchestra und komponierte bereits als Jugendlicher. Über mehrere Jahre hinweg war er als „Composer in Residence“ für das Boston Symphony Orchestra tätig, das auch zahlreiche seiner Kompositionen zur Uraufführung brachte. Seit 1971 lebt der Künstler in San Francisco. Dort hatte er von 1972 bis 1982 einen Lehrauftrag und leitete das New Music Ensemble. Diese Zeit prägte seinen kompositorischen Stil wesentlich, denn nach einer Schreibblockade erweiterte John Adams seine Stilistik und führte sie in neue Bahnen. Das berühmte Orchesterwerk Short Ride in a Fast Machine stammt aus dieser Schaffensphase und ist eines der am häufigsten aufgeführten Werke des Komponisten.
Eine enge Zusammenarbeit verbindet John Adams mit dem Librettisten und Regisseur Peter Sellars. Die Opern Nixon in China aus dem Jahr 1987 oder The Death of Klinghoffer (1991) brachten ihm den Ruf eines politischen Komponisten ein. Zahlreiche Auszeichnungen erhielt John Adams für sein Oratorium On the Transmigration of Souls in Gedenken an die Opfer von 9/11. Doch die Zuschreibung „politischer Komponist“ behagt dem Künstler, dessen Musik sich nicht kategorisieren lässt, nicht. Er nehme einfach nur die Themen, die das menschliche Leben ausmachen, und bringe sie in eine Kunstform. Musik sei für ihn eine Kunst, die man fühlen müsse. „Ich bin beim Schreiben dadurch motiviert, wie ich die Welt erlebe.“
Als Komponist und Lehrender wurde John Adams vielfach mit Ehrendoktoraten, Preisen und Grammy Awards ausgezeichnet, unter anderem für die Alben Harmonielehre und Short Ride in a Fast Machine. Ebenso erfolgreich ist der Künstler am Dirigentenpult: Er leitete und leitet zahlreiche international renommierte Orchester, unter anderem die Berliner Philharmoniker, das London Symphony Orchestra oder die Wiener Symphoniker.
Zum Werk
„Kennen Sie das, wenn jemand Sie bittet, in einem tollen Sportwagen mitzufahren, und dann wünschen Sie sich, Sie hätten es nicht getan?“ – mit dieser Anekdote veranschaulicht John Adams die Inspiration zum Werk Short Ride in a Fast Machine, mit dem Untertitel Fanfare für Orchester. Bereits der Werktitel impliziert die Ängste des Mitfahrenden. Die Musik ist ein Musterbeispiel jener Schaffensphase, in der John Adams die Minimal Music als Basis seines kompositorischen Ausdrucks verwendete. Sie ist gekennzeichnet durch „Wiederholung, gleichmäßigen Rhythmus und, was vielleicht am wichtigsten ist, eine harmonische Sprache mit einer Betonung der Konsonanz, die in der westlichen Kunstmusik der letzten fünfhundert Jahre ihresgleichen sucht“, fasst der Autor Michael Steinberg im Buch The John Adams Reader zusammen. „Adams ist kein einfacher – oder einfältiger – Künstler. Sein Anliegen war es, eine Musik zu erfinden, die zugleich vertraut und subtil ist. Trotz ihrer minimalistischen Züge sind die Werke (…) immer bezaubernd im Glanz und Schimmer ihrer Klangfülle und berstend vor Energie, die durch ihre harmonische Bewegung entsteht.“
Die Dynamik ist laut und rasant. Das Werk ist mit der Satzbezeichnung delirando versehen. Einleitend erklingt ein markanter Eröffnungspuls. Doch diese Pulsation kommt rasch in Konflikt mit anderen Motiven, die beispielsweise von vier Trompeten eingebracht und mit hektischen Einwürfen der Streicher kontrastiert werden. Dadurch entsteht eine Bewegung, die sich in mehreren thematischen Gegenströmungen stetig steigert.
Harmonisch stützt sich John Adams ganz auf die Konsonanzen und erzielt durch die sich überlagernden Obertöne eine voluminöse Resonanzkraft. Das groß besetzte Orchester ist mit einem umfangreichen Perkussionsapparat – bestehend aus Xylophon, Crotales, Glockenspiel, Becken, Tamburin, Tamtam und Synthesizer – ausgestattet.
Samuel Barber
Concerto for Cello and Orchestra, op. 22 (1945)
Fast jede und jeder Klassikliebhaber:in kennt das Adagio von Samuel Barber (1910 – 1981). Aber weitere Kompositionen? Mit einigen anderen Musikschaffenden teilt der amerikanische Komponist dieses Schicksal. Doch Samuel Barbers Œuvre ist groß, und auch sein Opernschaffen fand vornehmlich in Amerika viel Anerkennung. So gilt er in den USA als einer der erfolgreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Samuel Barber schuf einige Auftragswerke für berühmte Musiker:innen wie Vladimir Horowitz, Leontyne Price, Francis Poulenc oder auch Dietrich Fischer-Dieskau. 1935 erhielt er den American Prix de Rome, 1941 wurde er in die American Academy of Arts and Letters aufgenommen und 1961 in die American Academy of Arts and Sciences. 1958 erhielt er erstmals einen Pulitzer-Preis für die Oper Vanessa und 1963 einen zweiten für sein Klavierkonzert.
Samuel Barber wurde in West Chester, Pennsylvania, geboren, wo er aufwuchs und von 1924 bis 1932 Klavier, Komposition, Dirigieren und Gesang studierte. Zunächst trat er als Sänger in Erscheinung. Sein Gesangsstudium führte ihn auch zu John Braun nach Wien. Ein Aufenthalt an der American Academy in Rom war für den Komponisten ein entscheidender Ausgangspunkt für seine Karriere, denn dort lernte er Arturo Toscanini kennen. Der Dirigent förderte Samuel Barber nach Kräften und begründete damit seinen Weltruhm.
Während der Kriegsjahre von 1942 bis 1945 stand Samuel Barber in den Diensten der Air Force. Vorher war er drei Jahre als Kompositionslehrer tätig, doch dem Unterrichten konnte er nichts abgewinnen. Gemeinsam mit seinem Komponistenkollegen und Lebenspartner Gian Carlo Menotti wohnte Barber in Mount Kisco, nahe New York, wo ein Großteil seiner Werke entstand.
Zeit seines Lebens nahm Samuel Barber mit seiner musikalischen Sprache eine Sonderstellung innerhalb der Kompositionsgeschichte ein. Ihn kümmerten die stilistischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts wenig. Er orientierte sich an seinen Vorbildern Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin und Gabriel Fauré und schrieb in einem expressiven und lyrischen Stil. Dissonanzreibungen, rhythmische Verschiebungen und chromatische Tonreihen prägen zwar einige seiner Werke. In den Vordergrund stellte Samuel Barber jedoch immer die tonale Harmonik, der er ohne Kompromisse treu blieb. Er hatte eine Neigung für elegische, lang ausgebreitete melodische Bögen. Nur selten äußerte sich der Komponist zu seiner Musik, doch meinte er einmal, er fühle sich als eine „schattenhafte Figur aus einem anderen Zeitalter“. Weiter sagte er: „Man sagt, ich hätte überhaupt keinen Stil, doch das macht nichts. Ich werde meine Sache genau so weitermachen. Und dazu brauche ich, wie ich glaube, einen gewissen Mut.“
Weil Samuel Barber eine Ausbildung als Bariton hatte, konzipierte er seine Themen stets von einem vokalen Ausdruckswillen aus. Mit kontrapunktischen Mitteln und handwerklich auf höchstem Niveau verarbeitete er die melodischen Linien. Die Wesensart der Musik erinnert mitunter an Johannes Brahms, weshalb diese beiden Komponisten gerne miteinander in Verbindung gebracht wurden. Beide standen mit ihren kompromisslosen Kompositionsstilen außerhalb ihrer Zeit und wurden als konservativ abgekanzelt.
Schon die Werke seiner Studienzeit zeigen die Meisterschaft des Komponisten. Neben Symphonien entstanden auch Opern; ein Hauptaugenmerk galt dem Liedschaffen. Barbers neoromantische, lyrische und zugleich dramatische Musiksprache kam diesen Gattungen entgegen. Ein großer Verehrer des amerikanischen Komponisten war unter anderem Dietrich Fischer-Dieskau, der zahlreiche Lieder zur Uraufführung brachte. Bislang hat jedoch Samuel Barbers Lied- und Chorschaffen weniger Beachtung gefunden als seine Instrumentalmusik.
Zum Werk
Auf Vermittlung des legendären Kontrabassisten und Dirigenten Serge Koussevitzky kam Samuel Barber im Jahr 1945 mit der aus Russland stammenden Cellistin Raya Garbousova in Kontakt. In enger Zusammenarbeit mit der Interpretin entstand das Cellokonzert, das den Esprit der russisch sozialisierten Musikerin in sich trägt und höchst virtuos die unterschiedlichsten Klangregister des Cellos hervorkehrt. Nach der Fertigstellung schrieb Samuel Barbers Lebenspartner Gian Carlo Menotti: „Sam hat soeben ein Cellokonzert fertiggestellt, das dem Cellisten die Haare zu Berge stehen lässt.“
Großes war geplant mit diesem Auftragswerk, das Serge Koussevitzky mit dem Boston Symphony Orchestra und der Solistin im April 1946 präsentierte. Doch die Reaktionen blieben (vorerst) eher verhalten. Nach der Uraufführung überarbeitete Samuel Barber den virtuosen Finalsatz noch einmal, und die Cellistin Raya Garbousova verfeinerte ihre Interpretation immer weiter und setzte sich bis an ihr Lebensende als Botschafterin für das Cellokonzert ein.
Im Cellokonzert stellte Samuel Barber seine lyrische Ausdruckskraft zugunsten einer dringlich wirkenden, rhythmisch intensivierten Stilistik in den Hintergrund. So nimmt das Konzert mit zahlreichen theatralischen Kontrasten einen dramatischen Charakter an. Raya Garbousova merkte in einem Interview an, dass Samuel Barber in seinem Werk unter anderem die Musik der Native Americans anklingen lassen wollte. Gleich zu Beginn reißt das Orchester mehrere kurze Motive an, die später weiterentwickelt und ausgebreitet werden. Mit einer kurzen Solokadenz setzt das Cello ein, übernimmt sodann die Führung und formt die Themenfragmente aus. Drängend entwickelt sich der Satz hin zu einer virtuosen Kadenz. Das lyrische Andante sostenuto beruht auf einem wiegenden Siciliano-Rhythmus. Über einem sich wiederholenden Motiv im Bass wird das elegische Hauptthema entfaltet.
Dramatische Dialoge zwischen der Solostimme und dem Orchester bestimmen den Finalsatz. Teilweise wirken die Themenführungen rezitativisch und opernhaft. Das Werk endet zerklüftet und höchst virtuos.
Claude Debussy – La Mer
Trois esquisses symphoniques pour orchestre (1905)
(dt. Das Meer, drei symphonische Skizzen für Orchester)
Zwei Vorlieben prägten das künstlerische Schaffen des französischen Komponisten Claude Debussy (1862–1918) maßgeblich: Zum einen war er fasziniert vom Meer, vornehmlich vom Atlantischen Ozean. Zum anderen interessierte er sich sehr für asiatische Kunst. Beide Leidenschaften flossen in die dreisätzig angelegten symphonischen Skizzen La Mer ein.
Claude Debussy hat mit seiner kompositorischen Sprache die Musik des 20. Jahrhunderts maßgeblich mitgeprägt. Schon zu seinen Lebzeiten genoss er international ein hohes Ansehen. Aufgewachsen ist Claude Debussy in bescheidenen Verhältnissen. Er besuchte nie eine Schule; das Nötigste vermittelte ihm seine Mutter. Die Musik spielte im Elternhaus kaum eine Rolle. Der Vater hätte seinen Sohn gerne als Seemann gesehen. Oft und gerne fuhr das Kind zu seinem Taufpaten aufs Land. Dort wurde Nadeshda von Meck, die jahrzehntelang Peter I. Tschaikowsky finanziell unterstützt hatte, auf den Jugendlichen aufmerksam. Sie ermöglichte Claude Debussy ab dem zehnten Lebensjahr eine Ausbildung am Pariser Conservatoire und unternahm mehrere Reisen mit ihm. Als junger Künstler stand Claude Debussy ganz im Bann von Richard Wagner. Bald entwickelte er jedoch eine Hassliebe zu seinem übermächtigen Vorbild. Erst allmählich konnte er sich lösen und mit neuen Ideen eine individuelle kompositorische Sprache entwickeln.
Der Besuch der Pariser Weltausstellung im Jahr 1889 war für Claude Debussy ein Schlüsselerlebnis. Erstmals hörte er dort javanische Gamelanmusik. Die Wirkung der aus Bali stammenden Musik, die auf Metallophonen, Gongs, Trommeln und anderen Schlaginstrumenten gespielt wird, faszinierte den Künstler nachhaltig. Fortan entwickelte Debussy neue Skalenmodelle und rhythmische Muster, die die Taktmetren verschleiern und den Klangfluss in der Schwebe halten.
Privat durchlebte Claude Debussy oft turbulente Zeiten. Im Jahr 1905 trennte er sich von seiner ersten Frau. Auf Kosten seiner zweiten Partnerin, einer angesehenen Sängerin und Bankiersfrau, bezog er eine neue Wohnung. Kurze Zeit später wurde eine gemeinsame Tochter geboren. Ab 1910 wurde Claude Debussy von einer Schaffenskrise geplagt, die in einer kompositorischen Neuorientierung mündete. Der Erste Weltkrieg, finanzielle Sorgen sowie ein Darmkrebsleiden belasteten die letzten Lebensjahre des Komponisten schwer.
Zu Beginn der Arbeit an seinem Werk La Mer – im Jahr 1903 – schrieb Claude Debussy an seinen Freund André Messager, dass seine alte Liebe, das Meer, immer unschätzbar und schön sei, und führte weiter aus: „Sie wussten vielleicht nicht, dass ich für die schöne Laufbahn eines Seemanns ausersehen war, und dass nur die Zufälle des Daseins mich auf eine andere Bahn geführt haben.“
Nicht, wie man annehmen könnte, am Meer ist das groß besetzte Orchesterwerk entstanden, sondern weit abseits davon in der Bourgogne, in Zentralfrankreich. Die Intention des Komponisten war es, Erinnerungen an die Kindheit zu verarbeiten. Keine Klangmalerei wie eine reale, überwältigende Ansicht des Wassers sollte entstehen. Es sollte eine eher meditative Musik, eine Darstellung von subtilen Erinnerungen, Eindrücken, Stimmungen und Atmosphären erklingen. „Sie werden zu mir sagen, dass der Ozean nicht gerade die Rebhügel der Bourgogne bespült […], und dass die Sache wie eine Atelierlandschaft ausfallen könnte, aber ich habe zahlreiche Erinnerungen. Das taugt meiner Ansicht nach mehr als eine Wirklichkeit, deren Zauber im Allgemeinen zu schwer auf unseren Gedanken lastet“, schrieb Claude Debussy seinem Freund. Oft wurde La Mer mit der bildenden Kunst, speziell mit den Bildern des französischen Malers Claude Monet, in Beziehung gestellt. Der Reiseschriftsteller und Musikkritiker Camille Mauclair fasste die oft gesehenen Querverbindungen 1902 in Worte: „Die herrlichen Landschaften von Claude Monet sind nichts anderes als Symphonien aus Lichtwellen; und die Musik von Herrn Debussy, die nicht auf einer Folge von Motiven, sondern auf der jeweiligen Kraft der Klänge an sich basiert, kommt diesen Bildern besonders nahe; es ist ein Impressionismus aus Klangtupfern.“
La Mer ist für jedes Orchester ein Prüfstein, denn vielschichtig verwobene Klangfarbenspiele bringen die Musik zum Leuchten. Die Instrumentierung sei stürmisch und wechselhaft wie das Meer, schrieb der Komponist. Eigentlich könnte das Werk auch als dreisätzige Sinfonie betrachtet werden. Doch die musikalischen Linien werden nicht von melodisch-thematischen Überlegungen mitbestimmt. Raffiniert kombinierte und überlagerte Floskeln ergeben eine rhythmische Polyphonie, die weit in die kompositionstechnische Zukunft weist. Außerdem setzte Claude Debussy die Tonfortschreitungen mit einem neuartigen harmonischen Aufbau. Töne werden, ähnlich wie die Rhythmen, geschichtet. Damit erreicht er eine große Flexibilität und kann mit metrischen und abrupten dynamischen Wechseln die Klangoberflächen und den Untergrund plastisch ausformen.
All diese Errungenschaften wirkten auf das Publikum bei der Werkpräsentation fremd und eigenartig. Eine nur mäßige Interpretation bei der Uraufführung des Werkes trug darüber hinaus dazu bei, dass La Mer zunächst nicht auf Zustimmung stieß. Erst nachdem Claude Debussy 1908 seine symphonischen Skizzen selbst dirigiert hatte, kam die faszinierende Klangsprache zur Geltung.
Zum Werk
In den drei Skizzen beschreibt Debussy jeweils einen anderen Aspekt des Meeres, wie es bereits die Satzüberschriften andeuten. Der erste Satz, „Von der Morgendämmerung bis zum Mittag auf dem Meer“, zeigt mit flächigen Figuren sanfte Bewegungen und das Kräuseln des Wassers. Eine Arabeske entfaltet sich wellenförmig und bäumt sich am Ende auf.
Im zweiten Satz, „Spiel der Wellen“, werden Gischt und Wellengang musikalisch erfahrbar.
Der dritte Satz schildert einen Dialog zwischen Wind und Meer. Überlagerte Motive erzeugen eine leidenschaftliche Atmosphäre, spiegeln das Glitzern und Aufbäumen der Wellen sowie den aufbrausenden Wind. Als La Mer 1905 erschien, bestand Debussy darauf, dass Hokusais Holzschnitt Die große Welle vor Kanagawa die Titelseite der Partitur ziert.
Maurice Ravel
La Valse (Choreographische Dichtung für Orchester)
Maurice Ravel (1875–1937) wuchs in der südfranzösisch-baskischen Kleinstadt Ciboure auf, bevor er mit vierzehn Jahren ins Conservatoire in Paris eintrat. Großen Einfluss übten die Komponisten Emmanuel Chabrier und Erik Satie auf den jungen Ravel aus, der in der Kompositionsklasse von Gabriel Fauré unterrichtet wurde.
Ravel ist ein Meister der Verwandlung und der musikalischen Orchestrierung. Das Tonmaterial seiner Musik hat chamäleonartige Züge, es ist außerordentlich bildhaft und geformt aus einer großen Faszination für die körperliche Bewegung und den Tanz. Ravel, der sich von der Fremdheit und der Verkleidung verzaubern ließ und sich in einem märchenhaften Wechselspiel der Sinnlichkeit am wohlsten fühlte, schuf ein Klangideal, in das er volksliedhafte Elemente, Jazzphrasen und die Unterhaltungsmusik einbezog. Er liebte das Spiel mit unterschiedlichsten musikalischen Masken.
Auffällig ist, dass diese Masken fast ausschließlich aus vorromantischen Epochen und fremden Kulturen stammen. Aus seinen Werken spricht ein tiefes Unbehagen gegenüber der Kultur, in die er hineingeboren wurde. Deshalb führte ihn seine kompositorische Emigration weg von allem, was ihm zu nahestand. Fasziniert war er von der Volksmusik ländlicher Regionen, von der musikalischen Kunst in vorromantischen Epochen. Inspiriert wurde er von der Welt der Blumen und Vögel, fernen Ländern wie China oder Madagaskar, Spanien oder Griechenland. Am liebsten träumte er sich selbst in die Irrealität der Märchen- und Symbolwelt. Auf seiner Suche nach neuen musikalischen Wegen entdeckte er eine entfesselte Rhythmik, farbige Klangmalereien und eine glitzernde Instrumentationstechnik.
Sein berühmtes Werk La Valse beschäftigte den Komponisten über vierzehn Jahre. Bereits in einem Brief aus dem Jahr 1906 erzählt er, dass er einen Walzer plane, der eine Art Hommage an Johann Strauß sein solle. Bis 1914 sollte der Titel „Wien“ lauten. Im Laufe der Zeit änderten sich nicht nur der Titel, sondern auch die kompositorische Idee, denn es entstand eine „choreographische Dichtung“. Ravel sprach von einer „Apotheose des Wiener Walzers“, die „mit dem Eindruck eines fantastischen, fatalen Wirbels“ verknüpft sein soll.
Der berühmte Ballettchef Sergei Diaghilew hatte das Werk für sein Ballets Russes bestellt. Deshalb hatte der Komponist von Anfang an eine szenische Aufführung vor Augen, zu der er in der Partitur folgendes Bild entwarf: „Durch wirbelnde Wolken hindurch sind hier und da Walzer tanzende Paare erkennbar. Die Wolken verstreuen sich nach und nach und geben den Blick auf einen gewaltigen Saal frei, in dem sich eine Menschenmenge dreht. Allmählich wird die Bühne heller, bis im Fortissimo der volle Glanz der Kronleuchter erstrahlt. Ein Kaiserhof um das Jahr 1855.“
Nachdem die Komposition im April 1920 abgeschlossen war, brachten der Komponist und Marcelle Meyer dem Ballettchef die Fassung für zwei Klaviere zu Gehör. Anwesend waren auch Igor Strawinsky und Francis Poulenc. Dieser erinnert sich: „Als Ravel geendet hatte, sagte ihm Diaghilew: ‚Ravel, das ist ein Meisterwerk, aber das ist kein Ballett. Es ist das Gemälde eines Balletts.’ Strawinsky hingegen sagte zu meinem größten Erstaunen kein einziges Wort! Nichts! Es war für mein ganzes Leben eine Lektion in Bescheidenheit, dass Ravel ganz ruhig seine Noten nahm und hinausging, als ob nichts passiert wäre.“ Allerdings war Ravel von Diaghilews Ablehnung und Strawinskys Schweigen sehr gekränkt und brach den Kontakt zu beiden über Jahre hinweg ab. La Valse wurde zunächst konzertant uraufgeführt; erst 1929 realisierte Ida Rubinstein die Ballett-Premiere.
Zum Werk
La Valse besteht aus einer ununterbrochenen Reihe von Walzern; das Stück ist in zwei große Teile gegliedert. Im ersten Teil werden alle Melodien vorgestellt, im zweiten Teil wird kein neues musikalisches Material eingeführt, sondern in einer Art freier Reprise beginnt sich über die eleganten Walzer der „fatale Wirbel“ zu legen. Einzelne Themen erleben grundsätzliche Charakterwandlungen. Neben vielen fesselnden Details in der Orchestrierung treten die Harfe sowie eine kurze Passage im Schlagwerk besonders hervor. Die Streicherstimmen sind sehr dicht gesetzt; sie führen Glissandi über mehrere Takte. Die Wechsel zwischen dem Tutti und verschiedenen Instrumentengruppen schaffen farbenreiche orchestrale Expansionsräume.
Das Werk kulminiert auf einem Höhepunkt, der mit Schwellern und markant gesetzten Dreiklängen in den Trompeten, Violinen und Holzbläsern eingeleitet wird. Nach einem langen Orgelpunkt auf Ais wird die Auflösung zur Grundtonart hin buchstäblich bis zur letzten Note aufgeschoben. So entsteht eine imposant komponierte und orchestrierte Schlusspassage mit atemberaubender Spannung. La Valse wird von einigen Musikwissenschaftlern auch als apokalyptischer Totentanz verstanden, in dem Ravel seine Erfahrungen des Ersten Weltkriegs sowie den Schmerz über den Tod seiner Mutter verarbeitet hat. Vor allem die Coda mit den grellen Blechbläser-Glissandi und den Verschiebungen des Dreier-Metrums könnte als fratzenhaft verzerrter, mit politischen und gesellschaftskritischen Intentionen erfüllter Abgesang gedeutet werden.